Österreichischer Buchpreis 2025: Shortlist
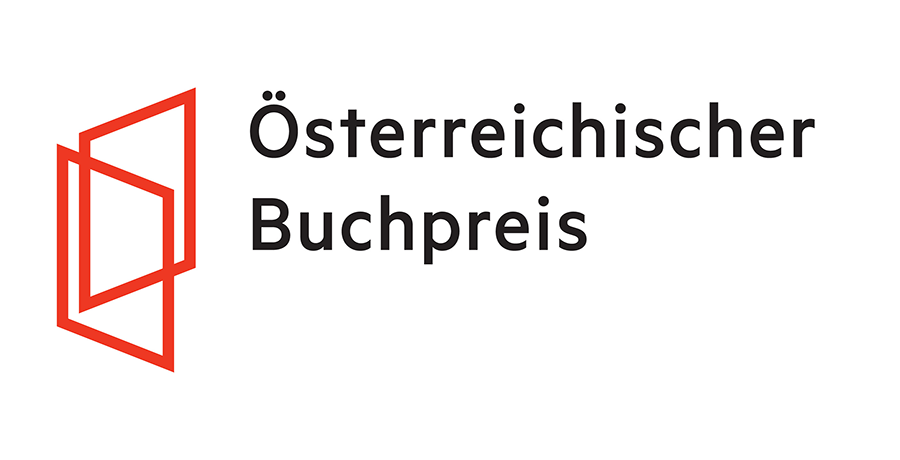
Die Shortlist des Österreichischen Buchpreises 2025 ist veröffentlicht. Nominiert sind fünf Titel für den Österreichischen Buchpreis 2025 und drei Titel für den Debütpreis. Eingereicht wurden dieses Mal 101 Titel, darunter belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke.
Der Österreichische Buchpreis wird gemeinsam vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.
Die Preisträgerin bzw. der Preisträger des Österreichischen Buchpreises erhält 20.000 Euro Preisgeld. Die vier weiteren Finalist:innen jeweils 2.500 Euro.Der Debütpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die beiden weiteren Debütpreis-Finalist:innen bekommen ebenfalls 2.500 Euro.
Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler:
"Auf die Shortlist des Österreichischen Buchpreises zu kommen, ist kein leichtes Unterfangen und für jeden Schriftsteller und jede Schriftstellerin eine große Ehre. Ich gratuliere allen Nominierten ganz herzlich zu diesem großen Erfolg. Ganz besonders möchte ich aber auch die Long- und Shortlist für den Debütpreis hervorheben. Die schriftstellerischen Neuzugänge in die große österreichische literarische Tradition verdienen besondere Aufmerksamkeit, sind sie doch die Zukunft unserer Literatur."
Shortlist für den Österreichischen Buchpreis 2025
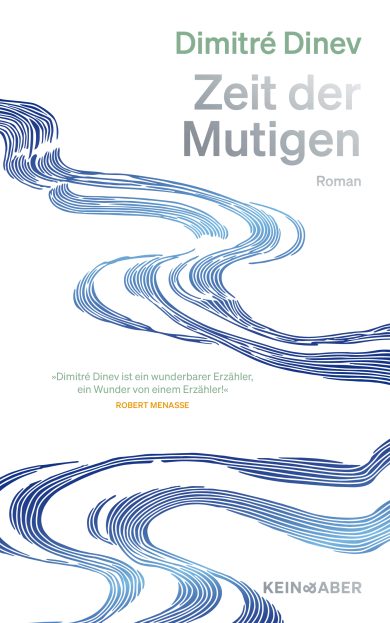
Jurbegründung:
Man steigt atemlos in diesen Text ein: Eva, ein Dienstmädchen, will sich in der Wiener Donau ertränken, verliert stattdessen ihre Unschuld in den Armen eines Leutnants, der Krieg bricht aus, sie wird Krankenschwester, sucht ihren Liebhaber, findet ihn, er erkennt sie nicht wieder, sie gibt ihm eine Chance, er nützt sie nicht, sie lässt seine Wunde nicht heilen, um ihn zu halten, lässt sein Bein amputieren, um ihn zu binden, doch er überlebt die Operation nicht. Das ist kein Spoiler, denn man hat bis an diese Stelle erst 15 Seiten gelesen. Wie kann der Autor diese Intensität 1200 Seiten halten, fragt man sich. Er kann.
Dimitré Dinev hat zwanzig Jahre an seinem Mammutroman Zeit der Mutigen gearbeitet: ein Panorama von vier Generationen, das sich von den Wirren der k. u. k. Monarchie über Faschismus und Kommunismus bis in die 1990er-Jahre spannt.
Im Zentrum steht Meto, eine schillernde Figur, die gleichsam als historischer Zerrspiegel durch die Epochen wandert. Seine Amnesie nach einem Kopfschuss im Zweiten Weltkrieg ermöglicht Dinev ein Spiel mit Identitäten, das in immer neuen familiären Verzweigungen aufgeht.
Ein Netz aus Geschichten entfaltet sich, in dem Kriege, Despotien und Zufälle die Schicksale der Menschen lenken und in dem die Donau als verbindendes, unaufhörlich fließendes Motiv alle Stränge zusammenhält.
Zeit der Mutigen ist ein Kraftakt, ein "totaler Roman", der an die großen Erzähler des 20. Jahrhunderts erinnert, aber eindeutig im 21. Jahrhundert beheimatet ist und in einer Reihe mit Roberto Bolaños 2666 oder Hilary Mantels Wolf Hall-Trilogie stehen kann. Ein humanistisches Monument von einem Buch, das größer ist als Österreich, und das zeigt: Die Zeit der Mutigen ist noch lange nicht vorbei.
Zum Autor: Dimitré Dinev
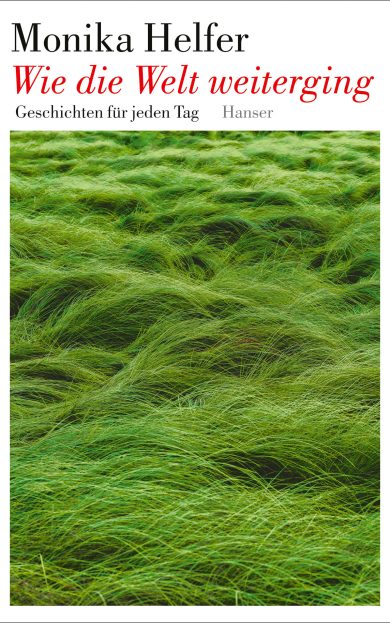
Jurybegründung:
Die Literaturgattung, die im Feuilleton und bei den Lesern, sich größter Beliebtheit erfreut, ist der Roman. Romane sind zumeist Sinnkonstruktionen, die die eventuelle Sinnhaftigkeit des außerliterarischen Lebens, also der sogenannten „Realität“, nachahmen. Das Buch von Monika Helfer "Wie die Welt weiterging", erschienen im Hanser-Verlag, ist kein Roman, sondern eine Sammlung von literarischen Einzelstücken. Man könnte sagen, es ist – wie ja auch die ganze Welt – ein Sammelsurium von Einzelheiten, die miteinander zusammenhängen, ohne dass man genau weiß wie.
Im Untertitel heißt das Buch ein wenig bieder: "Geschichten für jeden Tag" Das kommt davon, dass das Prinzip des Miteinanders der Texte im Buch "von außen" kommt und nicht inhaltlich-sinnvoll gerechtfertigt ist. Es sind, wie uns der Verlag wissen lässt, „365 Geschichten über die Welt und das Leben – persönlich, ehrlich, klug.“
Falls man keine Allergie gegen Verlagsprosa hat, wird man das so sehen können. Aber die vielen Geschichten bieten noch einen anderen Sinn. Sie stimmen mit dem Titel „Wie die Welt weiterging“ überein: Das Umblättern von einer Perspektive zu einer anderen, von einer Situation zu einer anderen, von einer Person zu einer anderen wird zu einem händischen (oder handgreiflichen) Abbilden davon, wie die Welt weiterging.
Zur Autorin: Monika Helfer
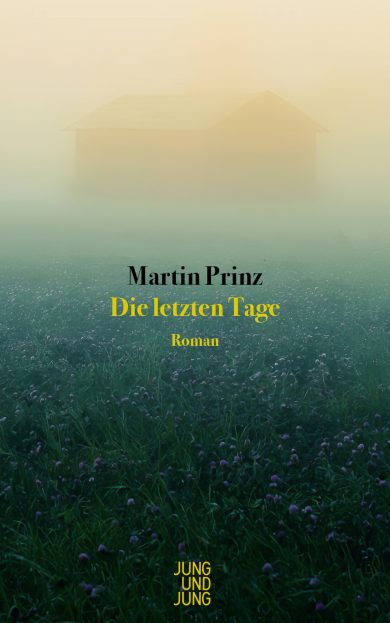
Jurybegründung:
Als die Alliierten schon weite Teile Österreichs besetzt hatten, verbreiteten die örtliche nationalsozialistische Kreisleitung und SA und HJ in der niederösterreichischen Rax-Schneeberg-Gegend im April 1945 Angst und Schrecken, erließen ohne gerichtlichen Auftrag standgerichtliche Todesurteile an Zivilpersonen und an teils minderjährigen Fahnenflüchtigen und vollstreckten diese unter öffentlicher Zurschaustellung der Leichname. 1948 werden die Hauptverantwortlichen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen.
Martin Prinz verbindet die Fakten, die aus jenen Prozessakten erhalten sind, mit eigener Vorstellungskraft zu einem verstörend eindringlichen literarischen Ganzen, in dem er die Ermordeten, denen auch die gerichtlichen Prozesse nach dem Krieg keine Stimme verleihen konnten, anspricht und damit als Personen fassbar macht, und indem er die Brutalität der Täter und die Angst der Opfer aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
"Die letzten Tage" ist ein Buch, das auf beklemmende Weise die Gewalt und gesteigerte Bereitschaft zu Gräueltaten vor Augen führt, die sich in autoritären Systemen noch angesichts ihres unweigerlichen Untergangs Bahn brechen. Ein Buch, das die Ausflüchte und Ausreden für Verbrechen und Kollaboration nach dem Krieg offenlegt und das Schweigen über das Geschehene, das sich bald nach den Gerichtsprozessen entwickelte, aufbricht.
Zum Autor: Martin Prinz
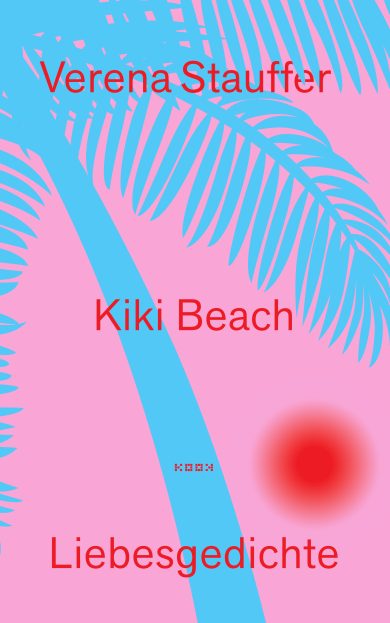
"Worte betreten die Bühne" – in sieben lustvollen Kapiteln variiert Verena Stauffer die Gattung des Liebesgedichts und entwirft, in Monolog, Rede und Gegenrede, ein grellbuntes Panoptikum von Formen des Begehrens in unserer Gegenwart.
Zwischen Zypern, Persien, Pompeji und der stets hinterfragten Heimat werden zahlreiche Register angeschlagen: Archaische Naturbilder interagieren mit Popkultur; Handynachrichten, Metaverse, KI-Partikel und Screenshots vermischen sich mit Ansichten ungeschützter Körperlichkeit. Hochkultur trifft auf Popmoderne, traditionelle Rhythmen auf "rough beats".
Mit praller Sinnlichkeit und mythologischer Wucht wird ein poetisches Panorama entfaltet, das zwischen Sex und Sehnsucht, Scham und Schauder, Rausch und Reflexion changiert. Vor krassen Gemeinplätzen scheut Kiki Beach dabei ebenso wenig zurück wie vor Künstlichkeit und Kitsch.
Wie liebt und wie lebt es sich im Hin und Her zwischen realen und digitalen Sphären? Wie entsteht Intimität?
Stauffers überbordende Bildwelten geben sich bald animalisch-pulsierend, bald sprachkritisch reflexiv. Dem Mythos der schaumgeborenen Aphrodite stellt die Dichterin zeitlich nähere Vorbilder gegenüber: Eavan Boland, Dylan Thomas, Walt Whitman, Travis Scott und andere werden als "Featuring"-Partner genannt.
Kiki Beach ist ein formal und inhaltlich herausfordernder Gedichtband, der das Genre des Liebesgedichts mit ungewöhnlichen Mitteln an seine Grenzen treibt. Übermütig, aber niemals beliebig, versteht sich das Buch als wilder, utopischer Entwurf einer zeitgenössischen Sprache der Liebe: "ein Zusammenspiel / Aus dem ein neues Land entsteht aus / Virtualität und Realität – beides ist echt".
Zur Autorin: Verena Stauffer
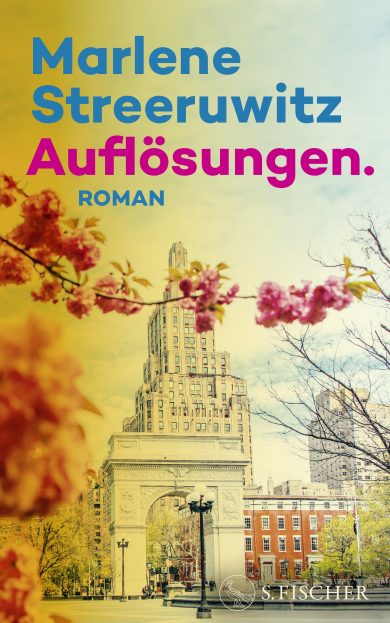
"Auflösungen" ist eine so präzise wie schmerzvolle Analyse unserer auf unterschiedlichsten Ebenen in Regression befindlichen Gegenwart.
Auch wenn der Roman im Wesentlichen in New York angesiedelt ist, wird darin Satz für Satz ein Zivilisationsverfall seziert, der weit über die USA hinausreicht: auch nach Österreich, vor allem in jene hartgesotten-marktgläubige Politik, die hierzulande unlängst als neue, konservative Bewegung gefeiert wurde.
In "Auflösungen" wird die Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche als Bedrohung nicht zuletzt für die Kunst sichtbar gemacht und damit als Gefährdung all jener Bereiche, die den emanzipatorischen Geist hochhalten und fördern. Im Zentrum steht, wie so oft bei Marlene Streeruwitz, eine Frau, Alleinerzieherin, Lyrikerin, die sich von einem Lehrauftrag in New York einen Neuanfang verspricht – einen, in dem das Leben frei gelebt werden kann jenseits patriarchal geprägter Bilder und Vorgaben.
"Auflösungen" ist ein zorniger, zugleich besonnener Text, in dem akribische Spracharbeit, intellektuelle Durchdringungskraft und progressiver politischer Furor zu überzeugender Form finden
– ein Roman, mit dem Marlene Streeruwitz erneut beweist, dass sie zu den eigenständigsten und damit gewichtigsten Autorinnen der Gegenwart zählt. Dass die Literatur die eigentliche Wissenschaft vom Leben ist: auch dieser Anspruch, den Marlene Streeruwitz immer wieder für die Literatur formuliert, findet in ihrem jüngsten Roman seine Realisation.
Zur Autorin: Marlene Streeruwitz
Shortlist - Debütpreis 2025
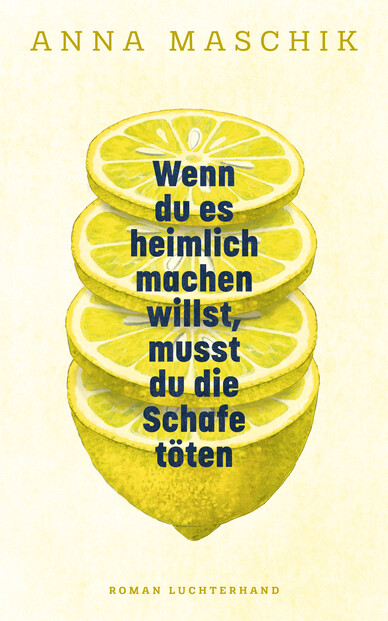
Jurybegründung:
Bildstark und eigensinnig: Anna Maschik legt mit ihrem Debütroman ‚Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten‘ einen kraftvollen wie zarten Text vor, in dem Schweigen gleiches Gewicht zukommt wie dem Sprechen.
Alles dreht sich in diesem Buch um Familie, um Herkunft, um Vorfahren – um weibliche zumal – und das auf eine Weise, die konventionell-kausales Denken außer Kraft setzt zugunsten der literarischen Veranschaulichung der Komplexität von Prägungen und Erbschaften. Aufzählungen, Listen spielen darin eine zentrale Rolle: sie markieren jenen Willen zum Fragmentarischen, der diesen Text in seinem Innersten vorantreibt auf etwas Offenes hin.
Zu diesem Offenen zählt: unterschiedlichste Metamorphosen, mit denen in diesem Roman das Rätselhafte, das Nicht-Entschlüsselte als machtvolle Realität gezeichnet wird. Ein luftiges Buch, zugleich ein zutiefst ernsthaftes, eines von außergewöhnlich hoher sprachlicher und dramaturgischer Genauigkeit
Zur Autorin: Anna Machik
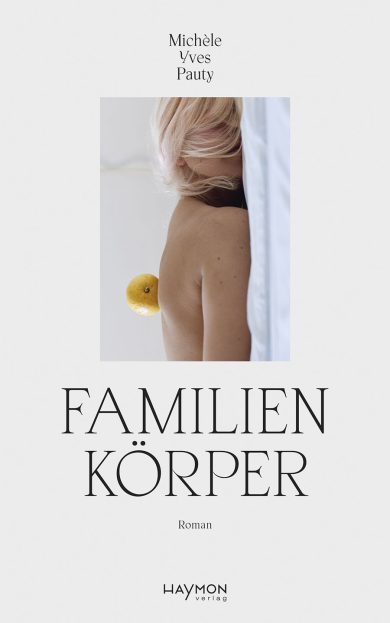
Der Literatur ist es nicht erlaubt, Form und Inhalt voneinander zu trennen. In Grenzen darf das die Literaturkritik: Das Buch „Familienkörper“ von Michèle Yves Pauty, erschienen im Haymon Verlag, ist inhaltlich von großer Bedeutsamkeit. Um es milde auszudrücken, führt der Roman die Irrtumsanfälligkeit des Medizinbetriebs vor Augen: „… danach haben sie mich an die Infusion gehängt, aber sie haben vergessen, sie aufzudrehen.“
Der Terminus „medical gaslighting“ kommt ins Spiel – als eine „spezielle Art des Psychoterrors mit dem Ziel, das Opfer an seiner mentalen Gesundheit zweifeln zu lassen.“ Der Umgang mit dem Postcorona Erschöpfungssyndrom hat das gaslighting zu einer erschütternden Mode unter Medizinern gemacht. Der Roman „Familienkörper“ ist darüber ein notwendiger Text der Aufklärung.
Der Roman heißt nicht „Familiengeschichte“, sondern „Familienkörper.“ Der Text beschreibt souverän und radikal (von der Wurzel her) den innerfamiliären Zusammenhang weiblicher Körper. Dadurch entsteht ein Bild von weiblichen Lebensläufen, und zugleich eine Antwort auf die alte Frage der Literatur: Was ist das - das Leben bis zum Tod? „Ich erzähle dir“, sagt die Ich-Erzählerin zu ihrer Mutter, „dass du im Roman stirbst. Du lachst.“
Zur Autorin: Michèle Yves Pauty

Miriam Unterthiners Theatertext Blutbrot nimmt sich eines Kapitels der Südtiroler Nachkriegsgeschichte an, das bislang kaum literarisch bearbeitet wurde: der Fluchthilfe für NS-Verbrecher über den Brennerpass. Figuren wie Eichmann oder Mengele passierten auf ihrem Weg nach Italien und weiter nach Südamerika eine Region, die heute gerne als idyllische Landschaft inszeniert wird und deren Mitverstrickung lange verdrängt blieb.
Unterthiner begegnet diesem schwierigen Stoff nicht mit dokumentarischem Realismus, sondern mit großer poetischer Wut und Wucht. Indem sie „Das Dorf“, "Das Brot" oder "Die Landschaft" selbst zu Figuren macht, öffnet sie den Blick auf Mechanismen kollektiven Schweigens und stellt Fragen nach Erinnerung, Verantwortung und Schuld.
Das Historische wird so zur Metapher für eine Gegenwart, in der Ressentiments und die Angst vor dem Fremden erneut virulent sind. Unterthiner erschafft eine kraftvolle Sprache, die bildstark und präzise das Verschüttete freilegt und dabei einen schreienden, oft verzweifelten Humor entwickelt.
Das Grundnahrungsmittel Brot wird dabei, unterstützt durch die Figur Max Brod, zur schwer verdaulichen Kost. Blutbrot zeigt, wie sich unsere grausame Geschichte in Körper, Sprache und Landschaft einschreibt und wie sie vielleicht doch durch einen "Nationalhumanismus" überwunden werden könnte.
Zur Autorin: Miriam Unterthiner
Die Jurymitglieder
- Katja Gasser
Leitung Literaturressort, ORF-TV - Stefan Kutzenberger
Literaturwissenschaftler, Universität Wien - Theresia Prammer
Schriftstellerin, Literaturkritikerin - Ulla Remmer
Buchhändlerin, Buchhandlung Franz Leo - Franz Schuh
Schriftsteller, Literaturkritiker
Termine
- Preisverleihung 10. November 2025
Am Abend der Preisverleihung, am Montag, den 10. November 2025 wird verlautbart, wer von den Nominierten den Österreichischen Buchpreis bzw. den Debütpreis erhält. Die Preisverleihung findet statt zum Auftakt der Buch Wien (12. bis 16. November 2025)